Ratio T3/rT3: Der Schlüssel zur Schilddrüsenstoffwechsel-Diagnose
Der Biomarker Ratio T3/rT3 ist ein wichtiger Indikator in der Labormedizin, um den Schilddrüsenstoffwechsel zu bewerten und Stoffwechselstörungen zu diagnostizieren. Er hilft dabei, eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine Nicht-Wellness-Diagnose zu erkennen, indem er das Verhältnis zwischen aktivem T3 und inaktivem rT3 misst. Seine Bedeutung liegt in der frühzeitigen Erkennung und differenzierten Behandlung von Schilddrüsenfunktionsstörungen.
Referenzbereich
4.2-11
Bedeutung niedriger Werte
Bedeutung niedriger Werte
Bedeutung hoher Werte
Bedeutung hoher Werte
Erhöhte Werte des Verhältnisses von freiem Triiodthyronin (fT3) zu reverse Triiodthyronin (rT3) im klinischen Kontext deuten auf eine verstärkte Umwandlung von inaktivem rT3 zu aktivem T3 oder eine vermehrte Bildung von T3 dar, was eine gesteigerte Schilddrüsenhormonaktivität widerspiegelt. Pathophysiologisch basiert das Verhältnis auf der Balance der 5'-Monodeiodinase-Aktivitäten, die T4 entweder zu aktivem T3 oder inaktivem rT3 umwandeln; ein erhöhtes fT3/rT3-Verhältnis zeigt somit eine gesteigerte 5'-Deiodinase-Aktivität zur Bildung von T3[5]. Mögliche Ursachen für ein erhöhtes Verhältnis sind Hyperthyreose, eine gesteigerte periphere Umwandlung von T4 zu T3 sowie selten Fälle von Schilddrüsenhormonresistenz, bei der trotz erhöhter Hormone eine unzureichende Wirkung an Zielzellen vorliegt[2]. Klinisch ist das Verhältnis hilfreich, um zwischen verschiedenen Ursachen von Schilddrüsenfunktionsstörungen zu differenzieren, insbesondere um das Sick Euthyroid Syndrom (bei dem das Verhältnis meist erniedrigt ist) von einer echten Hyperthyreose abzugrenzen[5]. Leitlinien empfehlen bei erhöhtem fT3/rT3-Verhältnis die weiterführende Diagnostik mit Messung von TSH, fT4 und gegebenenfalls Bildgebung der Schilddrüse sowie die Erfassung klinischer Symptome, um eine adäquate Therapie, beispielsweise mit Thyreostatika bei Hyperthyreose, einzuleiten. Therapeutisch richtet sich die Maßnahme nach der zugrundeliegenden Erkrankung, eine gezielte Behandlung der Hyperthyreose wird bevorzugt, während bei hormoneller Resistenz eine individuelle Betreuung notwendig ist[2].
Was sind Risikofaktoren die den Wert beinflussen können?

Erkrankungen und Infektionen
Schwere Erkrankungen wie Infektionen, Herzinfarkte oder Krebs können die Schilddrüsenhormone beeinflussen.

Alter und allgemeiner Gesundheitszustand
Bei älteren Menschen kann ein hoher Reverse-T3-Wert mit schlechterer körperlicher Leistungsfähigkeit verbunden sein.
Was kann helfen den Wert zu verbessern?
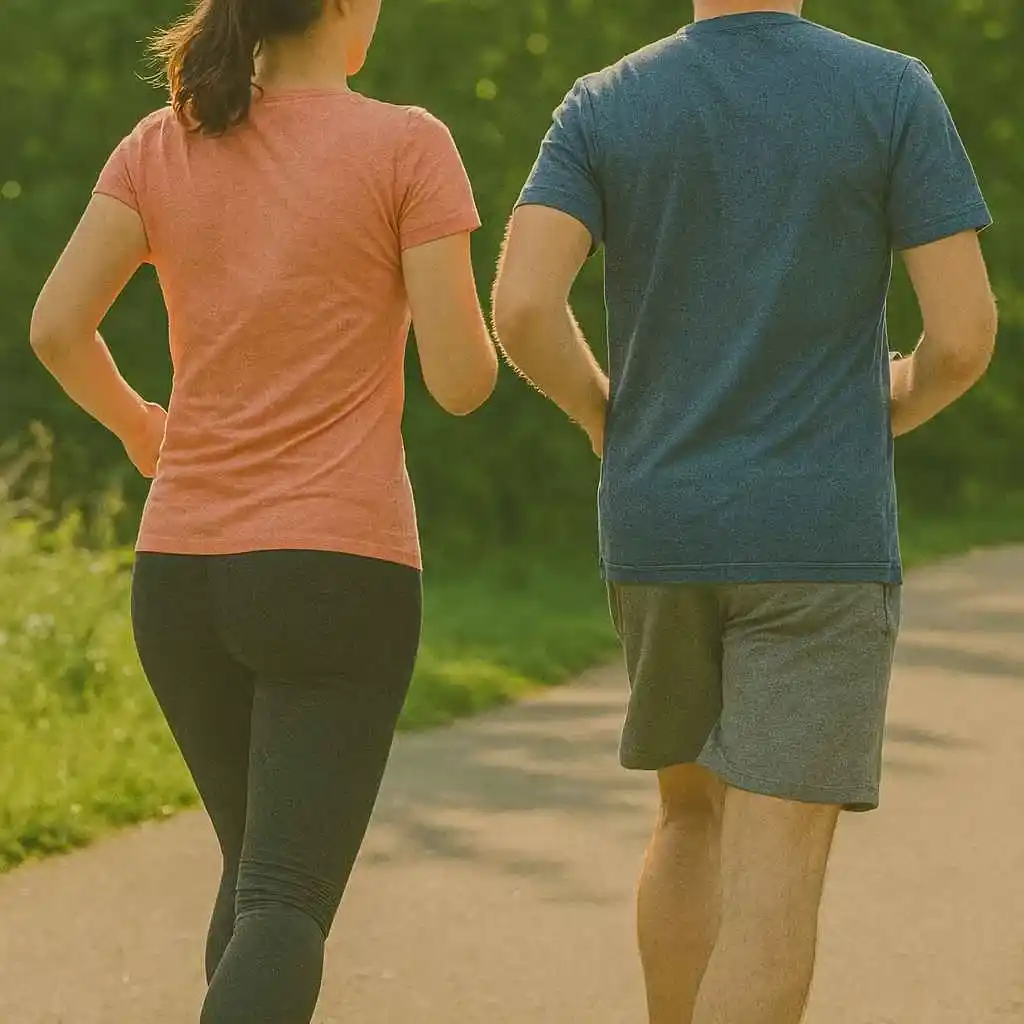
Regelmäßige Bewegung
Bewegung kann helfen, die Schilddrüsenhormone in Balance zu halten und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern (bei ME/CFS Pacing beachten!).

Stress abbauen und guten Schlaf fördern
Chronischer Stress und Schlafmangel können das Schilddrüsenhormon T3 senken und Reverse-T3 erhöhen. Entspannung und ausreichend Schlaf sind wichtig.

Ausgewogene Ernährung ohne strenge Diäten
Eine zu starke Kalorienreduzierung kann das Hormonungleichgewicht verstärken. Eine gesunde, nährstoffreiche Ernährung ist förderlich.

Nährstoffe optimieren
Jod, Selen, Zink und Eisen sind wichtig für die Schilddrüse. Eine gesunde Ernährung kann helfen, das Gleichgewicht der Hormone zu verbessern.
Ergebniserklärung
Niedrige T3/rT3-Ratio-Werte im klinischen Kontext deuten meist auf eine reduzierte Umwandlung des Vorläufers T4 in das aktive Hormon T3 hin, während das inaktive rT3 im Vergleich erhöht ist. Dies ist charakteristisch für das sogenannte Low-T3-Syndrom oder Euthyroid-Sick-Syndrom, welches häufig bei schweren oder akuten Erkrankungen wie Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, Leberzirrhose, diabetischer Ketoazidose, Anorexie, Sepsis oder nach Operationen und Traumata auftritt. Die pathophysiologische Grundlage liegt in der durch Entzündungsmediatoren (z.B. proinflammatorische Zytokine) und Stresshormone (z.B. Cortisol) induzierten Herabsetzung der Aktivität der Dejodinasen, welche die Umwandlung von T4 zu T3 steuern, während die Produktion von rT3 erhöht bleibt. Differentialdiagnostisch muss man zwischen einer essentiellen Schilddrüsenerkrankung und einem metabolischen Anpassungsmechanismus bei systemischer Erkrankung unterscheiden, da das Low-T3-Syndrom selbst meist keinen primären Krankheitswert besitzt, sondern eher als Schutzmechanismus interpretiert wird. Klinisch impliziert ein niedriger T3/rT3-Wert die Notwendigkeit, die zugrundeliegende schwere Erkrankung oder Stresssituation zu identifizieren und zu behandeln; eine isolierte Schilddrüsenhormontherapie ist in der Regel nicht indiziert. Weiterführende Diagnostik sollte neben Schilddrüsenfunktionsparametern auch Entzündungsmarker, Leberfunktionstests und den allgemeinen klinischen Zustand umfassen, um die Ursache abzuklären und gegebenenfalls Ernährungs• (z.B. Selen• und Jodstatus) oder Stressmanagementmaßnahmen zu ergreifen.
Erhöhte Werte des Verhältnisses von freiem Triiodthyronin (fT3) zu reverse Triiodthyronin (rT3) im klinischen Kontext deuten auf eine verstärkte Umwandlung von inaktivem rT3 zu aktivem T3 oder eine vermehrte Bildung von T3 dar, was eine gesteigerte Schilddrüsenhormonaktivität widerspiegelt. Pathophysiologisch basiert das Verhältnis auf der Balance der 5'-Monodeiodinase-Aktivitäten, die T4 entweder zu aktivem T3 oder inaktivem rT3 umwandeln; ein erhöhtes fT3/rT3-Verhältnis zeigt somit eine gesteigerte 5'-Deiodinase-Aktivität zur Bildung von T3[5]. Mögliche Ursachen für ein erhöhtes Verhältnis sind Hyperthyreose, eine gesteigerte periphere Umwandlung von T4 zu T3 sowie selten Fälle von Schilddrüsenhormonresistenz, bei der trotz erhöhter Hormone eine unzureichende Wirkung an Zielzellen vorliegt[2]. Klinisch ist das Verhältnis hilfreich, um zwischen verschiedenen Ursachen von Schilddrüsenfunktionsstörungen zu differenzieren, insbesondere um das Sick Euthyroid Syndrom (bei dem das Verhältnis meist erniedrigt ist) von einer echten Hyperthyreose abzugrenzen[5]. Leitlinien empfehlen bei erhöhtem fT3/rT3-Verhältnis die weiterführende Diagnostik mit Messung von TSH, fT4 und gegebenenfalls Bildgebung der Schilddrüse sowie die Erfassung klinischer Symptome, um eine adäquate Therapie, beispielsweise mit Thyreostatika bei Hyperthyreose, einzuleiten. Therapeutisch richtet sich die Maßnahme nach der zugrundeliegenden Erkrankung, eine gezielte Behandlung der Hyperthyreose wird bevorzugt, während bei hormoneller Resistenz eine individuelle Betreuung notwendig ist[2].
Quellen
- •https://flexikon.doccheck.com/de/Low-T3-Syndrom(Link)
- •https://www.klinik-st-georg.de/die-bedeutung-des-reverse-t3/(Link)
- •https://www.andrino.de/reverses-t3-rt3-der-schluessel-zum-perfekten-schilddruesenmedikament/(Link)
- •https://www.praxisamsachsenring.de/schilddruese-und-die-bedeutung-des-reverse-t3/(Link)
- •https://monapure.com/blogs/schilddruese/umwandlungsstoerung(Link)
- •https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC333152/(Link)
- •https://www.rupahealth.com/biomarkers/free-t3-reverse-t3-ratio(Link)
- •https://paulrobinsonthyroid.com/reverse-t3-what-is-it-and-what-it-means-for-thyroid-patients/(Link)
- •https://ibl-international.com/media/mageworx/downloads/attachment/file/3/0/30123153_ifu_eu_de_reverse_t3_elisa_v8_2024-03_sym9.pdf(Link)


